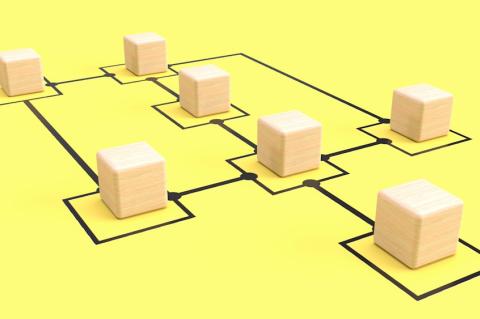Checkliste für Netzwerk-Stresstests (2)
Skalierbarkeit ist heute eine der wichtigsten Eigenschaften einer IT-Infrastruktur. Sie verspricht etwa, die Verfügbarkeit von Applikationen und Diensten auch bei einem deutlichen Zuwachs an Netzwerkverkehr sicherzustellen. Doch herauszufinden, wie skalierbar das eigene Netz ist oder einfach nur zu erfahren, wo im Falle einer hohen Belastung der Flaschenhals sitzt, ist äußerst komplex. In der Praxis nutzen IT-Verantwortliche dazu Stresstests, die durch Werkzeuge unterstützt werden, die eine künstliche Last im LAN erzeugen. Doch allein damit, unglaublich große Mengen an Bits und Bytes in die Leitungen zu pumpen, ist es nicht getan, denn die Ergebnisse solcher Tests sind nur in Verbindung mit den richtigen organisatorischen Maßnahmen im Umfeld wirklich aussagekräftig. Im zweiten Teil des Artikels gehen wir besonders darauf ein, wie Sie die Netzwerk-Anforderungen des eigenen IT-Betriebs ermitteln und wie Sie die Test-Last möglichst genau spezifizieren.
Ermittlung der Anforderungen des IT-Betriebs
Die allgemeinen Anforderungen aus Sicht des IT-Betriebs beschreiben die Grundanforderungen der Messmethodik. Bei der Formulierung der Anforderungen wird allgemein zwischen einem Dienstnehmer (Service User) und einem Diensterbringer (Service Provider) unterschieden. Weiterhin lässt sich differenzieren in Unternehmensleitung, IT-Leitung, IT-Fachbereiche und Anwender-Fachbereiche. Die Anforderungen an diese Personengruppen können in Abhängigkeit der Zugehörigkeit zu einem Dienstnehmer oder Diensterbringer variieren.
Bei Einhaltung der Anforderungen der Service-User zum Beispiel hinsichtlich kurzer Antwortzeiten ist mit einer Steigerung ihrer Produktivität zu rechnen. Im anderen Fall sind durch lange Wartezeiten oder bei Problemen mit der Verfügbarkeit von Anwendungen Frustrationen der Benutzer zu erwarten, die die Performance der betroffenen Geschäftsprozesse beeinträchtigen. Der Service-Provider ist demgegenüber an einer möglichst hohen Auslastung sämtlicher verwendeten Komponenten interessiert, um eine profunde wirtschaftliche Nutzung zu gewährleisten.
Beide Ziele sind jedoch in der Regel nicht gleichzeitig erreichbar, da kurze Antwortzeiten hohen Auslastungsgraden widersprechen. Sollte die Umsetzung einzelner Anforderungen durchführbar, aber aus Kostengründen nicht sinnvoll sein, müssen Sie Kompromisse finden. In vielen Fällen stimmen die Anforderungen von Service Provider und Service User überein, denn beide sind an einer gerechten Bewertung von Leistung interessiert und wollen ein möglichst günstiges Preis-/Leistungs-Verhältnis erreichen. Für eine optimale Zusammenarbeit sind genaue Definitionen der Schnittstellen zwischen den Kunden, den Lieferanten und den Partnern erforderlich.
Über ihre Dokumentation hinaus sind die Anforderungen der Geschäftsprozesse bezüglich Performance und Verfügbarkeit zu spezifizieren. Dabei sollten Sie darauf achten, die Anforderungen eindeutig und vor allem messtechnisch überprüfbar zu formulieren. Für alle kritischen Geschäftsprozesse sind die für einen reibungslosen Ablauf maximal erlaubten zeitlichen Beschränkungen festzulegen. Gegebenenfalls sind Anzahl und Umfang von Verletzungen dieser Grenzwerte zu fixieren.
Lasterfassung und Verkehrscharakterisierung
Um frühzeitig Engpässe zu erkennen, müssen Sie eine permanente Überwachung des Lastaufkommens und der Auslastung aller vorhandenen Komponenten sicherstellen. Sie sollten die erhobenen Messdaten aufbereiten und auswerten, um aus ihnen Trends abzuleiten und Zeitpunkte für mögliche Engpässe zu erkennen. Mit diesen Ergebnissen kann der Planungsprozess erneut beginnen.
Die erzielten Dienstgüten sollten Sie im laufenden Betrieb so erfassen, dass Sie rechtzeitig auf absehbare Verletzungen der vereinbarten Service-Level reagieren können. Bei Erkennung möglicher Dienstgüteverletzungen müssen Sie eine globale Analyse bezüglich vorhandener Engpässe und Schwachstellen durchführen. Für die gefundenen Engpässe müssen Sie die Ursache ermitteln: Mögliche Gründe können mangelnde Kapazität der genutzten IT-Konfiguration, fehlerhaftes Design der Anwendung beziehungsweise der gesamten Architektur oder organisatorische Mängel sein. Die Verfahren und Werkzeuge sollten die Analyse der Ist-Situation und die Prognose zukünftiger Szenarien aus Gesamtsystemsicht unterstützen.
Die Messungen müssen transaktionsorientiert erfolgen. Eine Messung oder Prognose von Ressourcenverbräuchen unterhalb der Ebene von Transaktionen (Datenpakete, Prozesse, I/O-Operationen) ist nicht ausreichend. Daher müssen Messung und Modellierung applikationsorientiert erfolgen, Ressourcenverbräuche müssen den Applikationen und Transaktionen zugeordnet werden können. Für die Kapazitätsplanung ist beispielsweise eine pauschale Aussage über die gesamte Bandbreitennutzung in den Netzen (LAN-Segment, Backbone, WAN) nicht ausreichend. Verweilzeiten an den Servern und Netzlaufzeiten bilden wichtige Basisinformationen für das Kapazitätsmanagement.
Spezifizierung der Last
Für die Analyse ist eine ausführliche Lastspezifikation erforderlich. Dabei sind neben der Festlegung von Normal- und Spitzenlasten auch Zusatz- und Hintergrundlasten zu berücksichtigen. Bei der Ermittlung von Performance-Daten müssen Sie folgende Kriterien unbedingt berücksichtigen:
- Differenzierung nach deutlich abweichendem Benutzerverhalten.
- Auswahl relevanter Benutzergruppen mit erwartungsgemäß nicht zu vernachlässigbarer Belastung des Gesamtsystems.
- Weiterhin müssen Sie die Anzahl der aktiven Arbeitsplätze und die Applikationstypen zur Angabe der zu vermessenden Anzahl von Arbeitsplätzen und der Verteilung der Applikationen festlegen.
Für jede Messreihe müssen Sie die folgenden Analysen durchführen:
- Ermittlung der exakten transaktionsspezifischen Antwortzeiten
- Überprüfung und Ermittlung der Auslastungsgrade der Systemressourcen
- Ermittlung der spezifischen Ressourcen-Verbräuche der stationären und temporären Prozesse
Dabei sollte Sie zunächst eine Bestandsaufnahme der Dienstgüte durch eine Ermittlung der transaktionsspezifischen Antwortzeiten durchführen. Anschließend erfolgt die Ermittlung der Grundlast, das heißt die Prozesse der ausgewählten Transaktionen sind ablaufbereit, aber inaktiv. Der letzte Schritt ist die Ermittlung der transaktionsspezifischen Ressourcen-Verbräuche an einem aktiven Arbeitsplatz.
Seite 1 von 2 Nächste Seite>>
Mathias Hein/jp/ln